Der Hegau ist immer noch lebenswert schön
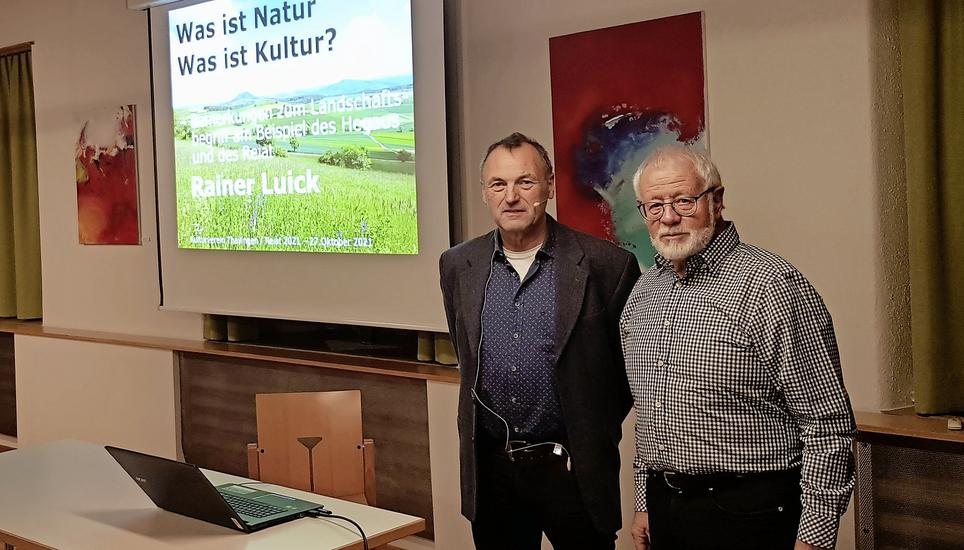
«Wir haben die Landschaften und die Natur, die wir verdienen, die unser individuelles Handeln gestalten», betont der Biologe Rainer Luick. Dies bedeutet aber auch: Jeder und jede Einzelne kann mit seinem persönlichen Verhalten etwas bewirken.
Der Vortrag «Hegau – Kultur oder Natur» von Rainer Luick, Professor für Natur- und Umweltschutz an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, beim Kulturverein Thayngen musste aus den allzu bekannten Gründen verschoben werden – und hätte gerade darum nicht aktueller sein können. Wenige Stunden zuvor bewilligte der Bundesrat sieben Windenergieanlagen im Kanton Thurgau. Eine davon allerdings nur unter Vorbehalt, weil sie den Fernblick von der Insel Reichenau aus beeinträchtigt und damit den Status der Insel als Unesco-Kulturerbe gefährden könnte. Der seit 30 Jahren in Riedheim-Hilzingen wohnhafte Referent kann darüber als engagierter Befürworter erneuerbarer Energien nur lachen – oder eigentlich nicht. «Das Problem sind nicht Windräder im Thurgau, sondern die intensivste Agrarnutzung. In weniger als 100 Jahren wurde das ursprüngliche Naturinventar der Insel beseitigt. Es gibt auf der Reichenau keine natürlichen oder naturnahen Lebensräume mehr», erklärte Luick und wies darauf hin, dass die Kirchenbesucher massive gesundheitliche Belastungen durch den direkten Kontakt mit Herbiziden und Pestiziden in Kauf nehmen würden.
Der Biologe begnügte sich jedoch keineswegs damit, mit eindrücklichen Beispielen und Zahlen die Gefährdung der Kulturlandschaft im Hegau und auch im Kanton Schaffhausen aufzuzeigen, vielmehr sprühte er vor lauter ansteckendem Optimismus. Er glaubt an die Realisierbarkeit der Energiewende (die Schweiz ist allerdings mit einem Anteil von 23 Prozent erneuerbarer Energien in dieser Hinsicht kein leuchtendes Beispiel) und er weist gerne auf positive Aspekte hin, wenn es solche gibt. So stammen, um beim Beispiel Reichenau zu bleiben, immerhin schon 30 Prozent des Gemüses aus ökologischem Anbau. Den Riederhof in Hilzingen bezeichnete der Referent sogar als «eine Oase der Ästhetik, des Wohlfühlens und der biologischen Vielfalt».
Dass es deutlich weniger Insekten gibt, welche die Windschutzscheiben der Autos zudecken oder das gemütliche Zusammensitzen im Garten beeinträchtigen, damit können wohl manche Menschen gut leben, doch Luick zeigte auf, dass damit auch der ökologische Kreislauf empfindlich gestört wird. Seit 1980 sind im Hegau zahlreiche Vogelarten vollständig verschwunden: das Rebhuhn, der Grosse Brachvogel, der Kiebitz, das Braunkehlchen, die Grauammer, der Baumpieper, die Heidelerche, der Berglaubsänger, der Waldlaubsänger, der Raubwürger und der Rotkopfwürger. Und bald wird die Liste noch länger: Wiedehopf, Hänfling, Feldlerche …
Kampf für und gegen Windmühlen
Besonders interessant für die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer im Restaurant Gemeindehaus war wohl die Konfrontation mit unserem Ästhetikempfinden, mit unseren inkonsequenten Sichtweisen. Wieso bewundern wir in den Ferien die wunderbar gepflegten Gärten und legen zu Hause pflegeleichte «Gärten des Grauens» (Rainer Luick) an? Wieso empfinden wir die alten oder rekonstruierten Windmühlen in Holland oder auf Kreta als touristische Höhepunkte und zu Hause nicht? Wieso wehrt man sich gegen grössere Windparks, wenn es doch 1855 in Holland 10 000 Windmühlen gewesen sind und auf der Lasithi-Hochebene in Kreta bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg sogar 12 000? Und wieso ist für uns die 1838 auf dem neuen Damm zur Reichenau angelegte Pappelallee schön, obwohl sie die Sicht auf die Klosteranlagen verstellt und es sich bei Pappeln um einen genetischen Hybrid handelt, der den heimischen Insekten nichts nützt und ein hohes allergisches Potenzial darstellt?
Meist begnügte sich der Umweltschützer, Zusammenhänge aufzuzeigen und Fragen zu stellen – sodass die nachdenklich gestimmten Zuhörerinnen und Zuhörer sich selbst die richtigen Antworten geben mussten. Doch manchmal sagte er es auch deutsch und deutlich: «Die Pappelallee muss dringend entfernt werden.»
«Wir haben die Landschaften und die Natur, die wir verdienen, die unser individuelles Handeln gestaltet», gab Luick als Fazit zu bedenken. «Nicht nur die anderen sind daran schuld: die Politik, die Industrie, der Handel, die Produzenten und Landnutzer, die globalen Vorgaben, die gesellschaftlichen Normen und Kapitalinteressen. Auch wir, die Individuen, die Verbraucher, stehen in der Pflicht und können mit unserem Verhalten Entscheidendes bewirken.»
0,1 Prozent unberührte Natur
Ursprüngliche Naturlandschaften gibt es in unserer deutschen Nachbarschaft übrigens nur noch drei (0,1 Prozent der Fläche): die Linden-Blockschuttwälder am Hohenstoffeln und am Hohenkrähen, die Mündung der Radolfzeller Aach in den Bodensee und die Schilfröhrichte im Wollmatinger und Radolfzeller Aachried. Und als Urwald der Zukunft kommt der Hohentwielwald hinzu. 1890 wurde der kahle Hohentwiel als hässlich empfunden. Deshalb wurden 12 000 Bäume und Büsche gepflanzt. 1923 wurde das Gebiet zum Bannwald erklärt, den man vollständig sich selbst überlässt. Seither sind die exotischen Arten verschwunden und die einheimischen Baum- und Straucharten haben sich durchgesetzt. Die Natur kann manches korrigieren, wenn man ihr die Chance lässt.



