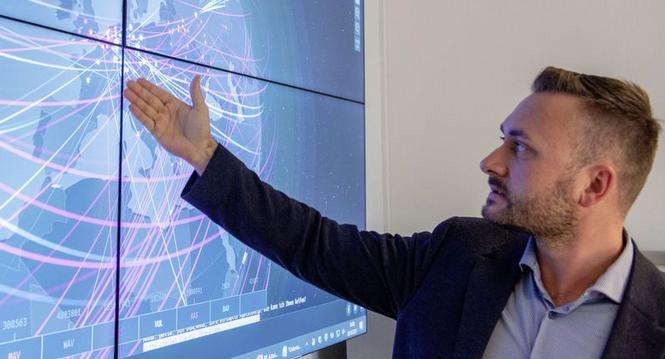Das Prinzenmärchen zieht noch immer
Die Polizei braucht mehr Spezialisten, um die steigende Zahl der Internetkriminalität bewältigen zu können. Viele Täter können allerdings nicht gefasst werden, weil sie aus dem Ausland operieren.
Diesen Fall werde er wohl nie vergessen, sagt Philipp Maier, Chef der Schaffhauser Kriminalpolizei. Da stand dieser Mann am Schalter, beschämt und mit den Nerven am Ende. Er hatte auf Skype mit einer ihm unbekannten Frau per Video gechattet, das Gespräch war erotisch aufgeladen, schliesslich forderte sie ihn auf, sich selbst zu befriedigen. Er tat es, vor laufender Kamera, sie auch. Nach dem Chat dann der Schock: Per Mail forderte ihn die Frau auf, Geld an ein Konto zu überweisen. Tue er das nicht, schicke sie das Video an seine Freunde. Maier sieht den Gesichtsausdruck des Mannes noch heute, viele Jahre später, vor sich: «Er sah aus, als würde er sich gleich etwas antun.»
Der Mann war ein Opfer von Sextortion geworden. Dabei wird eine Person mit Bild- oder Videomaterial erpresst, das sie meist bei sexuellen Handlungen oder nackt zeigt. Die Opfer – meist sind es Männer – werden aufgefordert, Geld auf ein Konto zu überweisen, ansonsten werde das Bildmaterial an Familie, Arbeitgeber oder Freunde weitergeleitet. Sextortion ist eine Art von Cybercrime, also Kriminalität, die im Internet stattfindet. Die Fälle nehmen rasant zu. 2009 gingen 7541 Meldungen dazu beim Bundesamt für Polizei ein, 2016 waren es bereits 14 033. Die Kantonspolizei Zürich hat eine Fachstelle Cybercrime eingerichtet, im Frühling bewilligte der Regierungsrat eine Personalaufstockung.
Viel Schaden mit wenig Aufwand
So weit ist man in Schaffhausen noch nicht, auch wenn die Polizei Cybercrime-Spezialisten hat. In der Kriminalstatistik werden Cybercrime-Fälle nicht explizit ausgewiesen. Die allermeisten könnten einem klassischen Delikt wie Betrug, Erpressung oder Pornografie zugewiesen werden, sagt Maier. Doch auch ohne konkrete Zahlen ist klar, dass die Fälle von Jahr zu Jahr mehr werden. Bereits im Mai warnte der Chef der Kriminalpolizei, dass es mehr Spezialisten brauche, um die Fälle bearbeiten zu können. Wie viele Mitarbeiter es aktuell sind, will die Polizei aus taktischen Gründen nicht sagen. «Der Ausbau in diesem Bereich steht aber ganz oben auf unserer Prioritätenliste, da die Zahl der Delikte weiter zunehmen wird», so Maier.
Für Kriminelle sei das Internet so verlockend, weil man mit wenig Aufwand viel Schaden anrichten könne, so Maier. Er unterscheidet zwei Bereiche. Zu Cybercrime im engeren Sinn gehört alles, was beim Täter einigermassen vertiefte IT-Kenntnisse voraussetzt: Hacking, Phishing oder Malware. Unter Cybercrime im weiteren Sinn versteht man etwa Sextortion, Cybermobbing oder Erpressung.
Mit einem der bekanntesten Mittel war wohl jeder, der eine E-Mail-Adresse besitzt, schon einmal konfrontiert: Im Posteingang landet eine Mail von einem netten Herrn aus einem afrikanischen Land, der vorgibt, Millionenerbe eines verstorbenen Prinzen zu sein. Überweise man ein paar Hundert Franken zur Deckung von Anwaltskosten an ein ausländisches Konto, werde man grosszügig am Erbe beteiligt. «Wenn von 100 000 angeschriebenen Personen 1 Promille darauf reagiert, hat man schon eine hübsche Summe zusammen.»
Prinzenmärchen zieht noch immer
Dass das Angebot des angeblichen Millionenerben zu schön ist, um wahr zu sein, ist zwar mittlerweile auch bei unerfahrenen Internetnutzern angekommen. Trotzdem gebe es immer noch Leute, die darauf hereinfielen, sagt Maier. Sorgen machen ihm aber eher Betrüger, die so professionell vorgehen, dass selbst erfahrene Anwender darauf hereinfallen: «Betrügerische Software wird immer besser.» Anfang Oktober warnte die Melde- und Analysestelle Informationssicherung Melani des Bundes vor Phishing-Attacken auf Datenaustauschplattformen von Firmen. Dabei werden Websites von Anbietern wie OneDrive nachgebaut; werden dort Benutzername und Passwort eingegeben, haben Kriminelle Zugang zu Firmendaten.
Steuerung aus dem Ausland
Egal ob bei Hacking, Money Mules oder Malware: Ein grosser Teil des Cybercrime wird aus dem Ausland gesteuert. Werde etwa ein Computer gehackt, sei es fast unmöglich, den Tätern auf die Spur zu kommen, sagt Maier – trotz kantonalem, nationalem und internationalem Austausch der Polizeiorgane. Lasse sich ein Täter hingegen geografisch einordnen, etwa mit der Ortung der IP-Adresse eines Computers, gebe es immer wieder «schöne Erfolge». Gearbeitet wird auch mit Telefonüberwachung oder mit der Auswertung von Computerdaten. «Aber wir müssen ehrlich sein: Als kleiner Kanton haben wir nicht viele Möglichkeiten.»
Kommt hinzu: Zahlreiche Delikte werden gar nie erfasst, weil sie nicht zur Anzeige gebracht werden. Einerseits, weil die Opfer sich bewusst sind, dass es sehr schwierig ist, den Täter zu ermitteln. Andererseits, weil sie sich schämen. Die einsame Seniorin, die sich auf einer Online-Datingplattform in einen Unbekannten verliebt und ihm eine beträchtliche Summe geschickt hat, weil er ihr von Geldsorgen berichtet hat. Der Mann, der seinen Monatslohn in ein Online-Schneeballsystem gesteckt hat. Der Jugendliche, der auf Facebook gemobbt wird. «Von aussen fragt man sich oft: Wie konnte er oder sie nur so naiv sein? Doch man sollte vorsichtig sein mit solchen Vorverurteilungen», sagt Maier. «Gerade wenn es um Gefühle geht, findet man wohl bei jedem eine Schwäche.»
Manipulierte Telefonnummern
Die Präventionsarbeit im Bereich Cyberkriminalität passiert auf verschiedenen Ebenen. Unter anderem warnt die Polizei vor aktuellen Betrugsmaschen, zuletzt vor Telefonbetrügern, die technisch manipulierte Telefonnummern anwendeten und das Vertrauen der angerufenen Person zu gewinnen versuchten. Und sie setzt bei der Altersgruppe an, die das Handy am meisten nutzt: Jugendliche. Mediensprecher Patrick Caprez etwa leistet Präventionsarbeit an Schulen. Was ihm auffällt: «Die Jugendlichen kennen sich im Internet besser aus als ihre Eltern.» Diese wüssten oft nicht, wo sich ihre Sprösslinge online herumtrieben. Vielen Jugendlichen wiederum sei nicht klar, welche Folgen ihre Handlungen haben.
Als Beispiel nennt Caprez ein Video, das 2013 bei Jugendlichen die Runde machte. Darauf ist eine junge Frau zu sehen, die sexuelle Handlungen mit einer Eisteeflasche vornimmt. Ihr Exfreund soll das Video gegen ihren Willen ins Internet gestellt haben. Das Video wurde nicht nur unzählige Male geschaut, sondern auch auf Facebook geteilt. «Dieses Video wird die Frau ihr ganzes Leben lang beschäftigen», ist Caprez überzeugt. Und Jugendliche, die es auf ihrem Handy gespeichert hatten, mussten mit Konsequenzen rechnen. Die Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich eröffnete gegen neun Jugendliche ein Verfahren wegen Kinderpornografie, weil die junge Frau zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht 16 Jahre alt war.
Ein extremes Beispiel. «Aber ich staune manchmal schon, wie leichtfertig sich Leute im Internet bewegen», sagt Maier. Vor allem, wenn das darum geht, persönliche Informationen online zu stellen. Fotos vor allem. «Das Internet vergisst nichts, das muss einem bewusst sein.» Ist ein Bild einmal veröffentlicht, verschwindet es nie mehr aus dem Netz, auch wenn es gelöscht wird. «So kann ein unvorteilhaftes Foto aus der Jugendzeit Jahre später bei einer Bewerbung zum Verhängnis werden.»
Und der Mann, der auf Skype erpresst wurde? Was aus ihm geworden ist, kann Maier nicht sagen. Man sollte auch in der grössten Verzweiflung niemals auf einen Erpressungsversuch eingehen und auf keinen Fall Geld überweisen. Insofern habe der Mann alles richtig gemacht: Er ging zur Polizei. «Denn es ist überhaupt nicht sicher, dass eine Erpressung bei der ersten Zahlung aufhört. Im schlimmsten Fall geht sie immer weiter.»